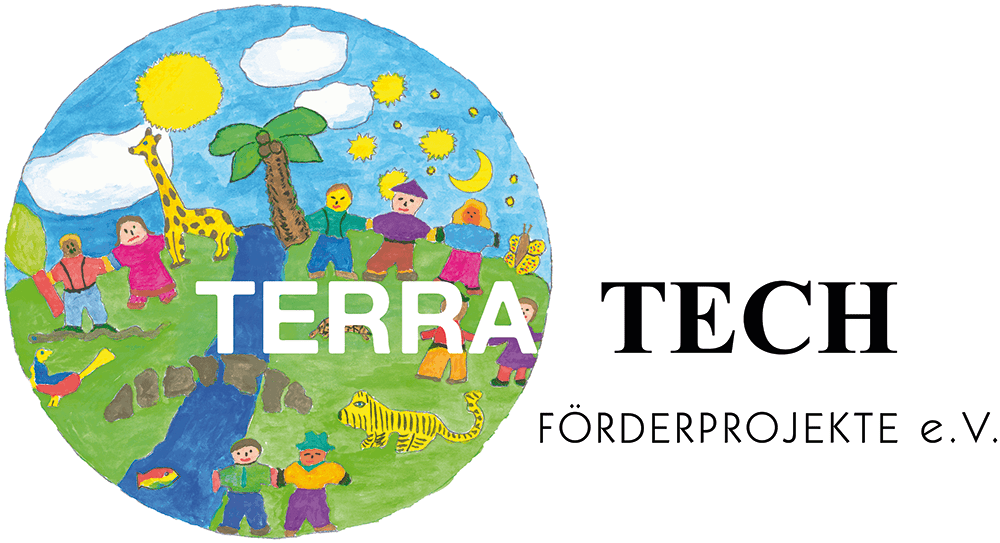„Enkuwan Dehna Metu! – willkommen“ – Hayat Mohammed empfängt uns unter dem Vordach ihres Hauses in Kombolcha. Die Mittdreißigerin wohnt gemeinsam mit ihrem Sohn, ihrer Mutter und weiteren Verwandten. Zu fünft teilt sich die Familie einen Schlafraum und einen Lagerraum.
Von außen sind die Wände aus Holzplanken mit Lehm verkleidet, der Boden vor dem Haus ist mit getrockneten Gras bedeckt. Innen sind die Wände mit Plastikplanen abgehängt. Auf dem PVC-Boden liegen einige Schlafmatten und Decken. Ansonsten ist der Raum recht spärlich eingerichtet. Es gibt zwei Plastikhocker, ein Metallgestell mit einem Kessel, einen kleinen Tisch einer traditionellen Kaffeekanne und einem Wäschekorb voller Tassen. An der Wand hängt ein glänzender Bilderrahmen. Die durch den Raum gespannten Stromkabel führen zu einigen Steckdosen und der einzigen Glühlampe, die den Raum schummrig beleuchtet.
Das Gespräch vor dem Haus findet in einer wuseligen Situation statt. Nachbarn und Kindern schauen neugierig vorbei. Hayat Mohammed berichtet uns von ihren Fluchterfahrungen. Vor 14 Jahren hat sie Äthiopien illegal verlassen. „Um Geld zu verdienen,“ wie sie sagt. 13 Jahre dauerte diese Odyssee. Ihr Weg führte nach Saudi-Arabien. „‘Delalas‘ (Schleuser_innen) besorgten mir ein Flugticket, ein Visum und einen Vertrag als Hausmädchen.“ Für eine junge Frau, die nach der neunten Klasse die Schule verlassen hatte, klang dies traumhaft. Dafür war sie auch bereit, ein kleines Vermögen zu investieren. „10.000 Äthiopische Birr verlangenden die Schleuser_innen, viel Geld vor 14 Jahren. Das Geld für die Reise hat mir meine Familie geliehen.“ Der Traum stellte sich aber schnell als Alptraum heraus. Die Situation am Arbeitsplatz war katastrophal. „Ich musste bis zu 24 Stunden täglich arbeiten. Das Essen war nicht gut und reichte selten aus.“ Schlaf war Luxus. Mohammed war die einzige Arbeitskraft im sehr großen Haus. „Putzen, kochen, waschen und Babysitting, das Pensum war zu viel für mich.“ Dazu kamen die Sprachbarriere und körperliche Gewalt. „Oft wurde ich angeschrien. Teils auch misshandelt.“ Auch die Bezahlung war nicht, wie versprochen. In den ersten drei Monaten erhielt sie gar keinen Lohn. „Warum? Das weiß ich nicht. Eventuell ging das Geld an die Schleuser_innen?“ Dann wurde ihr weniger gezahlt, als ursprünglich vereinbart. Nur einmal im Monat durfte sie Kontakt zur Familie in Äthiopien aufnehmen. „Dazu musste ich das Telefon meiner Arbeitgeber_innen nutzen. Ich selbst durfte kein Telefon besitzen.“
Irgendwann hielt sie die Situation nicht mehr aus. „Ich floh von meinen Arbeitgeber_innen. Lebte mit anderen Migranten auf der Straße und verdingte mich als Tagelöhnerin.“ Schließlich wurde sie verhaftet und nach Äthiopien abgeschoben. Wie sich herausstellte, war sie die ganze Zeit illegal in Saudi-Arabien. „Das versprochene Visum hatte ich nie bekommen.“ An dieser Stelle wird Mohammed sehr emotional. Die Mundwinkel verkrampfen. Die Frau gestikuliert aufgeregt.
Zurück in Äthiopien fand sie wieder eine dramatische Situation vor. Die Familie hatte das Geld, welches sie aus Saudi-Arabien sandte, aufgebraucht. Mit ihrem Sohn stand sie vor dem Nichts. „Es war schrecklich. Nichts wurde gespart. Ich war wieder dort, wo alles begann.“ Mit dem wenigen Geld, das sie noch hatte, eröffnete sie einen kleinen Kaffeestand. Doch ohne Erfolg. Mit dem Verkauf einer Tasse Kaffee erwirtschaftet sie fünf Äthiopische Birr, weniger als 15 Eurocent, zu wenig für das Auskommen der Familie. Zudem gab es bürokratische Hindernisse. „Es war schwer für mich einen Ausweis zu bekommen. Denn ich hatte keinerlei Papiere.“ Zurückgekehrt in ein Leben ohne Perspektive ist Mohammeds Blick in die Zukunft wenig hoffnungsvoll. „Die einzige Chance, meine wirtschaftliche Situation momentan zu verbessern, wäre nochmals nach Saudi-Arabien zu gehen.“ Vor diesem Hintergrund hat sie eine deutliche Forderung an die Regierung. „Die Lebensbedingungen müssen verbessert werden. Wer Hoffnung hat, sieht auch seine Zukunft in Äthiopien.“
Seit sieben Monaten nimmt Mohammed an den von unserer Partnerorganisation Kelem organisierten Gesprächsrunden in ihrer Gemeinde teilt. Sie warnt die Jugendlichen und deren Familien vor den Dingen, die die Flüchtlinge erwarten. Neben den schrecklichen Erinnerungen und den wirtschaftlichen Problemen hat Mohammed auch körperliche Andenken behalten. „Die Chemikalien, die ich zum Putzen nutzen musste, haben meine Sehfähigkeit stark beeinträchtigt. Zudem habe ich Nieren-Probleme bekommen.“ Mohammed weiß, dass sie ein wenig gegen Windmühlen kämpft. „Eltern schicken ihre Kinder aufgrund der ökonomischen Situation fort. Viele wissen, wie schlimm die Situation ist und drängen ihre Kinder trotzdem.“ Aber ohne mehr Jobs sowie Unterstützung und Raum für Jugendliche wird illegale Migration immer ein vermeintlicher Ausweg sein. Zumal die Schleuser_innen überall warten. „Man kann einfach nach der Nummer fragen.“ Immerhin, sie kennt einige Familien, deren Kinder blieben. Diese kleinen Erfolge geben auch Hayat Mohammed ein wenig Hoffnung.